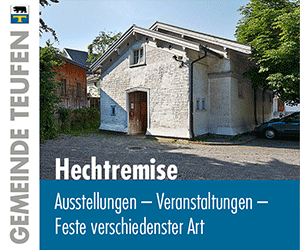Man könnte mit dem Offensichtlichsten beginnen: dem Schnee. Schliesslich fällt er an diesem Donnerstagabend in dicken Flocken. Und wie man weiss, lag zum Zeitpunkt von Robert Walsers letztem Spaziergang auch Schnee auf den Hügeln oberhalb von Herisau. Das war an Weihnachten, am 25. Dezember 1956. Die vorangegangenen 23 Jahre verbrachte der Schriftsteller, der später als einer der «wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts» bezeichnet werden wird, in der Heil- und Pflegeanstalt Herisau. Warum kam der in Biel geborene Walser ins Appenzellerland? Die Antwort darauf hat Daniel Ehrenzeller parat. Er begrüsst die Gäste im Singsaal des Roten Schulhauses (NT) als Präsident der Lesegesellschaft: «Er wurde hierher versetzt, weil er Bürger von Teufen war. Das überrascht natürlich nicht.» Anschliessend übergibt er das Wort an zwei, die damit sehr gut umzugehen wissen: Christian Hettkamp und Hans-Rudolf Spühler. Sie spielen an diesem Abend das Stück «Die Aussprache» von Barbara Auer. Uraufführung war vor zwei Jahren in – wie könnte es anders sein – Herisau.
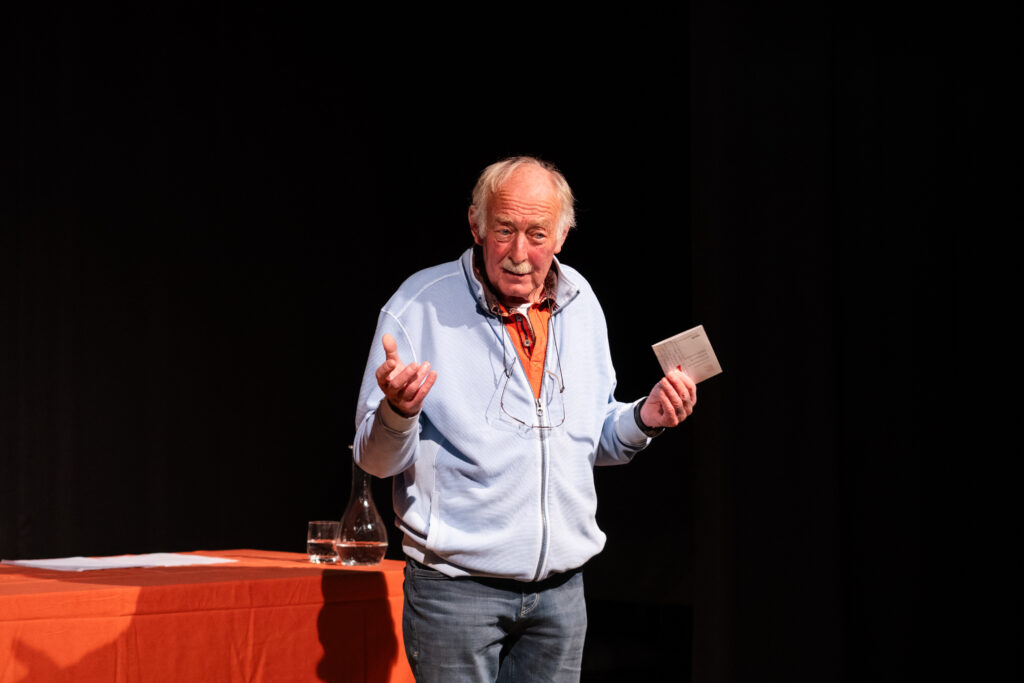

Den Dialog initiiert Hans-Rudolf Spühler als Carl Seelig. Er ruft seinen ehemaligen «Lieblingsdichter» aus dem Schatten, dem Tod, hinter den Zuschauerreihen herbei. Christian Hettkamp willigt dem Gespräch als Robert Walser erst nur zögerlich zu: «Was gibt es denn noch zu bereden?» Bald stellt sich heraus: ziemlich viel. Zum Beispiel die konkrete Schilderung von Walsers Tod im Buch «Wanderungen mit Robert Walser» von Carl Seelig. Sie erfährt eine gnadenlose Textkritik des widerauferstandenen Walser: fiktiv, kitschig, Kokolores. «Ich war ja gar nicht mehr am Leben, als dieses Buch erschien. Ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt zu ergänzen, zu korrigieren und zu erweitern.» Vielleicht also doch nicht mit dem Offensichtlichsten beginnen. Und schon gar nicht kitschig sein.
Eine Beziehung?
Das Schöne an diesem Stück: Man muss weder Walser- noch Seelig-Kenner sein, um es geniessen zu können. Die Zuhörenden erfahren während des gut eine Stunde dauernden Dialogs viel Biographisches aber auch Persönliches aus dem Leben der zwei Literatur-Persönlichkeiten. Car Seelig, Schriftsteller, Journalist und Mäzen, suchte während Robert Walsers Zeit in Herisau den Kontakt zu ihm und wurde im Jahr 1934 dessen Vormund. Er besuchte Walser 44 Mal und 44 Mal gingen die zwei spazieren. Oder wandern? Diese Differenzierung ist eine der ersten Streitpunkte des Abends. Walser besteht auf der Bezeichnung Spaziergang, während Seelig seinen Buchtitel so verteidigt: «Einmal sind wir von Herisau bis nach Lichtensteig. Das sind an die 40 Kilometer. Und einmal bis nach Wil, auch eine ziemlich stattliche Distanz. Da darf man doch wohl von Wanderungen sprechen.» Wo sie sich einig sind: Einkehren, eine gute Mahlzeit, ein oder zwei Glas Wein und ein paar Helle am Abend im Bahnhof-Bistro (leider auch Geschichte) gehören auf jeden Fall dazu.

Sie sprechen aber nicht nur über Literatur und gutes Essen – es geht auch ans Eingemachte. Walser konfrontiert Seelig mit dem Vorwurf, die Beziehung zu ihm für seine publizistischen Zwecke missbraucht zu haben. Seelig fragt Walser endlich direkt, was er denn von seiner Bewerbung als Vormund gehalten habe. Und zwischendurch glaubt man als Zuhörender fast, eine Art Liebesgeständnis miterleben zu dürfen. Aber Robert Walser fegt die Sache vom Tisch. Das ist dann doch ein bisschen zu viel Emotionalität für ihn. Trotzdem: Auch er kann nicht leugnen, dass Seelig wohl einfach «eine gute Seele» habe. Er ist sowieso erstaunlich ausgewogen, dieser Dialog. Es geht nicht nur um die Grandiosität von Walser, sondern auch um die fast manische Selbstlosigkeit von Seelig. Die zwei entblössen sich psychisch vor dem Publikum. Dabei kann es auch mal laut werden.
Frauen, Spoerri, die grosse Frage
«Sie waren verheiratet?» Das Erstaunen des Dichters wirkt echt. Wie eigentlich alles, was heute Abend auf der Bühne zu sehen ist. Carl Seelig hatte gerade eine Art Geständnis abgelegt; darüber, was ihm nach Walsers Tod widerfahren war. Er hatte seine todkranke Frau Martha bis zum Schluss gepflegt und sich danach manisch in die Arbeit gestürzt. Jetzt aber dreht er den Spiess um: «Wenn wir schon bei Thema sind: Bei Ihnen gab es doch auch eine Frau. Was ist mit Frieda Mermet?» Wieder diese abweisende Handbewegung. Aber Seelig lässt nicht locker: «Ich weiss, dass sie Sie zweimal jährlich besucht hat. Trotz der zweitägigen Reise. Und dass sie ein feines Gespür für Ihre Texte hatte.» Allzu viel bringt er leider trotz Stochern nicht aus dem leicht verlegenen Walser heraus. Immerhin bestätigt er seine Zuneigung zu Frieda und wechselt dann wieder gekonnt das Thema. Über Umwege gelangen die beiden zu einer der Kernfragen des Abends: «Sagen Sie, Herr Seelig, sind die Erzählungen und Dialoge in ‘Wanderungen’ wahrhaftig oder haben Sie sie erdichtet?» Nach einem kurzen Hin und Her gibt Seelig zu, dass wohl einige Details abgeändert wurden. Erfunden habe er die Gespräche aber nicht: «Das kann ich doch gar nicht. Man hätte den Seelig im Walser sofort erkannt.» Ein anderer Streitfall ist der Besuch des Dr. Theodor Spoerri in Herisau im Jahr 1954. Während Walser das Gespräch mit dem «jungen Burschen» sehr genossen hatte, war es Seelig ein Dorn im Auge. Er untersagte als Vormund weitere Besuche. «Warum denn? Er hat mich verstanden.» Erst geniert sich Seelig, bis er schliesslich, halb schreiend, gesteht: «Ich war eifersüchtig! Eifersüchtig auf diese Inseln der Klarheit, die ihr euch anscheinend geteilt habt.»
Das Gespräch der zwei dauert über eine Stunde. Und es endet ähnlich abrupt, wie es begonnen hatte. Anfangs wollte Seelig von Walser wissen, ob er denn Stachelbeeren möge. Worauf dieser antwortete: «Ich denke an Wurst.» Am Ende dann, als die Verabschiedung naht, drucksen die zwei so rum, wie man es von sich verabschiedenden Männerfreunden kennt. Walser bringt schliesslich ein «Ich bin nicht ungern mit Ihnen gewandert» über die Lippen. Damit scheint er immerhin bei der Bezeichnung «Wanderung» eingeschwenkt zu haben. Für das «Du» reicht es aber auch nach dem Tod noch nicht. Das wäre dann wohl zu kitschig gewesen.